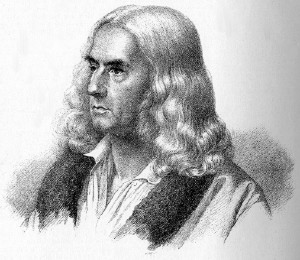Der Schöneberger KleistparkEine Eule wundert sich.. |
Beim Fotografieren des etwas versteckten Kleistparks in Schöneberg traf ich Eulivia, die mich natürlich gleich ausfragte, was ich mache. Eulivia: Ja das stimmt. Ich war dabei, als die Leute von baumschlau die angebracht haben. Das ist echt toll!! Aber leider kann ich die Schilder nicht lesen. Was steht denn da drauf? Ich: Du sitzt gerade auf dem Ast einer Gleditschie. Das ist ein ausgefallener Baum. |
 |
| Viele interessante Baum-Namensschilder |
Eulivia: Schreibst du also nur über die Bäume, die hier stehen? Ich: Nein. Ich schreibe über die Geschichte des Kleistparks, wie er entstand. Das ist sehr interessant, wusstest du, dass das hier mal der Botanische Garten war? Ja, mit vielen Pflanzen, nicht nur mit Bäumen! |
 |
| Sonnige Kolonnaden |
Eulivia: Ich glaub, davon hab ich schon mal was gehört! Erzähl bitte weiter! Eulivia: 1679....Das ist aber lange her. Und wann wurde es zum Botanischen Garten? Ich: Also ab Anfang des 19. Jahrhunderts entstand der richtige 7,5 Hektar große Botanische Garten. Der erste Berlins.
Carl David Bouché war als technischer Direktor im Botanischen Garten tätig. Er hat das berühmte 17 m hohe Palmenhaus entworfen, welches im königlichen Botanischen Garten gebaut wurde. Außerdem entwarf er auch das Victoria-Regia-Haus, also das Seerosenhaus. Diese beiden Gewächshäuser wurden im neuen Botanischen Garten in Berlin-Dahlem neu gebaut, aber die Pflanzen wurden übernommen. So gibt es einen Palmfarn der auch schon im alten Botanischen Garten stand. Die Seerose ist eine Pflanzenkreuzung und stammt auch von Carl David Bouché. Eulivia: Und warum ist hier kein Botanischer Garten mehr? Eulivia: Ok, daher der Name Heinrich-von-Kleist-Park. |
 |
| Blick auf das Kammergericht |
Ich: Hey Eulivia, ein paar von den Bäumen, die du hier siehst, gab es sogar schon, als hier der Botanische Garten war. Ich: Hmmm im Gegensatz zu dem Garten oder Park ist das Gebäude nicht alt. Ein schönes Gebäude. Es heißt Kammergericht. Es wurde 1913 fertiggestellt. Ich: Eulivia. Hier vor dem Kammergericht standen eigentlich mal zwei Figuren. Die Rossenbändiger des Baron v. Clodt. Sie waren ein Geschenk vom Zar Nikolaus I. Für seinen Schwager Friedrich Wilhelm IV. im Jahre 1842. Das Volk bezeichnete diese Geste als “gehemmten Fortschritt” und als “beförderten Rücktritt”. Sie wurden vor der Lustgartenfront des Stadtschlosses des Königs Friedrich Wilhelm IV. errichtet. Seit dem Ende des 2. Weltkrieges standen sie hier vor dem Kammergericht. Zur Zeit (2008) stehen sie in dem Berliner Museum “Hamburger Bahnhof”. Ich: Siehst du hier auf der ovalen Wiese, wie viele unterschiedliche Bäume hier stehen?! Die sind ein Denkmal für den ehemaligen Botanischen Garten. Hier zum Beispiel haben wir eine dicke große Eiche. Sie ist ein Naturdenkmal. Und da hinten im Zentrum der Wiese steht die Flügelnuss, es ist der größte Baum hier im Heinrich-von-Kleist-Park. Und dort drüben Eulivia, steht die Sumpfzypresse. Sie und der amerikansiche Geweihbaum hier sind sehr seltene Bäume. Oh und den hübschesten Baum hätte ich glatt vergessen. Sieh nur, dort steht der Ginkgobaum. Dieser stammt aus China. Er hat sehr auffällig aussehende Blätter. Die Chinesen meinten, die Blätter sehen aus wie Frauenhaar, weil sie zarte, feine Linien haben. Eulivia: Ja, ich liebe diese Bäume hier. Sie sind alle wunderschön. Und sie geben uns Eulen viel Raum zum Bewohnen. Ich: Aber eigentlich wollte ich dir etwas ganz anderes zeigen. Nämlich die Wiese. |
 |
| Unter der Wiese wird Regenwasser von Plastik-Rigolen aufgefangen - das spart Abwasserkosten |
Ich: Weißt du was sich unter dem Rasen befindet, Eulivia? Eulivia: Unter dem Rasen ist Erde, oder? Ich: Das stimmt schon und 3 m unter der Rasenoberfläche ist schon Wasser. Und dazwischen wurden vor einer Weile Rohr- und Kastenrigolen gebaut. Das sind so eine Art Auffangbecken. Sie speichern das Regenwasser, das von den Straßen durch die Gullis und die Rohre zu den Rigolen fließt. Eulivia: Aber werden die Rigolen-Kästen denn nicht irgendwann überfüllt sein? Ich: Ja, das könnte man denken, aber die Rohr-Rigolen haben Schlitze und die Kasten-Rigolen haben Löcher, wodurch das Wasser langsam in die Erde sickern kann. Um zu verhindern, dass das viele Wasser schneller in die Erde sickert, wurde noch ein Geotextil, also eine Art Stoff um die Rigolen gespannt.
Text: Vanessa Polzin |